The Lobster als dystopische Hyperbel moderner Entfremdung

The Lobster erzählt von einer dystopischen Gesellschaft, in der Menschen nur in Paaren öffentlich leben und agieren dürfen. Wer seinen Partner verliert oder keinen findet, wird in ein Hotel einquartiert. Dort hat er eine festgelegte Zeitspanne zur Verfügung, einen Partner zu finden. Bleibt dies ohne Erfolg, wird er in ein Tier verwandelt. Die einzige Alternative wäre, sich als Individualist in den Wäldern aufzuhalten, unter der Gefahr, wie ein Tier von den Hotelinsassen gejagt zu werden. Was auf den ersten Blick als Phantasiegeschichte anmutet, ist eine zugespitzte Allegorie auf die Funktionsweise menschlicher Denkweisen in der zivilisierten Welt. The Lobster ist eine Hyperbel der modernen Entfremdung.
In der Gesellschaft des Films gibt es eine eindeutige Hierarchie, sozusagen eine Nahrungspyramide, die aber nicht auf tatsächlich unterschiedlicher Wertigkeit beruht, sondern auf der willkürlichen Annahme, dass Paar-Menschen mehr wert sind als Anschluss suchende Einzelmenschen und diese wiederum mehr wert sind als ein individualistischer Single. Für den sich besser gestellt Denkenden wird der als niederer Gehaltene zum Tier – im Film buchstäblich. Ist es nicht dasselbe Prinzip, mit dem viele Menschen andere betrachten, die nicht mit ihren mentalen Konditionierungen konform gehen? Seien es Ausländer, Andersdenkende oder eben tatsächlich einfach nur Freiheitsliebende? Werden Flüchtlinge, denen ihre Reise von der zivilisierten, angeblich christlich orientierten Zivilisation eher erschwert als erleichtert wird, nicht auch zu Tieren degradiert, die man durch die Wälder streifen lässt? Wer ununterbrochen seine Welt in bestimmte Schemata zwängt, über alles mit 1 und 0 urteilt, entfremdet sich von seinem eigenen Ursprung. Es gibt nur eine Welt und somit ist auf der absoluten Ebene alles 1. Andere als geringer wertig zu klassifizieren entspringt einem falschen Verständnis von sich selbst. Daraus lässt sich die Maxime ableiten, dass jeder sich frei entfalten können sollte, solange seine Entfaltung die Freiheit des anderen beinhaltet bzw. gewährleistet. In der Gesellschaft von The Lobster hingegen scheint die Einschränkung des anderen oberste Maxime.
Die Krankheit des menschlichen Verstandes ist es, jedes Phänomen in Kategorien zu unterteilen und dies nicht nur zu einem relativen analytischen Zwecke, sondern auf eine ideologisch-absolute Art und Weise. Und so erzählt The Lobster nicht die Geschichte einer fremden Welt, sondern einer Gesellschaft, der es unglaublich schwer fällt, bedingungslos zu lieben. Bedingungslose Liebe darf nicht als romantisch verklärtes Begehren verstanden werden, sondern als das Gegenteil: Voraussetzungsfreie Wertschätzung, ohne etwas vom anderen zu wollen. Da jeder Mensch ohne kulturelle Voraussetzungen als Singularität geboren wird, ist dies unsere wahre Natur. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, heißt es. Das bedeutet: freier Wille für jeden bei gleichzeitiger transzendentaler Gemeinschaft. Eine gelungene Paar-Liebe ist der optimale Ausdruck dieses Prinzips. Stattdessen wollen viele Menschen andere Menschen nach ihrer Vorstellung formen oder sogar negieren, wenn er dieser nicht entspricht. Teilen nicht manche Online-Dating-Seiten Menschen ebenfalls einander nach oberflächlichen Kriterien zu?
The Lobster inszeniert diesen Umstand auf eine radikale Art und Weise. Wie viel Zuneigung Paare füreinander empfinden, ist irrelevant. Eine Partnerschaft wird nur dann als offiziell tauglich anerkannt, wenn äußerliche Kriterien übereinstimmend sind. So fälscht ein Hotelgast ein chronisch auftretendes Nasenbluten, um mit einer Frau, die diesem Leiden tatsächlich unterliegt, zusammen sein zu können und der Verwandlung in ein Tier zu entrinnen. Um eventuellen Zwistigkeiten entgegenzuwirken, wird dem Paar ein Kind hinzugefügt. Das Kind ist also nicht das Produkt einer Liebensgemeinschaft, sondern ein kalkuliertes Instrument. Es wird nicht um seiner selbst willen geliebt, sondern für die Bedürfnisse von anderen benutzt. Dies veranschaulicht einen Irrglauben unserer Zeit: dass man andere benötigt, um selbst vollständig und richtig zu sein.
Dass viele Lebensgemeinschaften auf der Angst vor jenem verhängnisvollen Alleinsein beruhen, scheint im Film belanglos. Selbst angebliche „Matches“, die von vollständiger Gefühlskälte und Abneigung geprägt sind, werden als gelungener Zusammenschluss beklatscht. Zusätzlich tragisch scheint, dass dieses Gesellschaftssystem nicht von einer Machtelite oktroyiert wird. Zumindest bleibt eine solche unsichtbar. Es sind vielmehr die einzelnen Teilnehmer selber, die die entfremdete Ordnung tragen, weil sie sich den konditionierten Üblichkeiten, den gemeinsamen Glaubenssätzen fügen – trotz emotionaler Offenkundigkeit ihrer Falschheit. Sie sind um ihr eigenes Weiterbestehen bedacht und gehen dafür paradoxerweise freiwillig in einem faschistoiden System unter. Das wird deutlich, indem auch die Individualisten im Wald derart rigide Verhaltensregeln aufstellen, dass ihre Freiheit nicht auch die Freiheit des anderen ist. Stattdessen gestalten sie sich als ein Abbild, eine Spiegelung, der faschistoiden Despotie der Paar-Ordnung. Nachdem unter den Einzelmenschen im Wald bekannt wird, dass der Protagonist David und seine Geliebte ein geheimes Verhältnis pflegen und unter dem Kriterium einer gemeinsamen Sehschwäche ein öffentliches Paar werden wollen, lässt man die Geliebte blenden. Der Wald ist also nicht wie so oft ein Ort der Natürlichkeit, sondern ebenfalls Schauplatz zwischenmenschlicher Pathologie. Nichtsdestotrotz nutzt der Film diesen Umstand, um aufzuzeigen, dass bedingungslose Liebe unausrottbar ist, eben weil sie der eigentliche Grundsatz des Lebens ist: David nimmt sich selbst das Augenlicht, um weiterhin mit seiner namenlosen Geliebten zusammen sein zu können. In diesem Akt werden höchste Entfremdung (die Verstümmelung des eigenen Körpers und der eigenen Vermögen aufgrund gesellschaftlicher Normen) sowie transzendierende Selbstlosigkeit (Hingabe ohne von dem anderen einen Zugewinn zu erwarten) vereint.
Der Film visualisiert sein Thema in kargen Farben, kühlen Dialogen, kargen Gesichtern, namenlosen Figuren mit empathielosem Verhalten, monoton-tragischer Musik und minimalistischen Einstellungen. Damit hinterlässt er ein schaurig-stimmiges Gesamtbild. Nur an einer Stelle irrt er und beweist damit gleichzeitig, dass es um unsere Gesellschaft nicht so schlecht steht, wie er es in seiner hyperbolischen Dimension inszeniert: Im Wald tanzen die Individualisten ausschließlich zu elektronischer Musik, jeder für sich allein. Doch jeder, der schon auf unkommerziellen Veranstaltungen elektronischer Tanzmusik war, weiß dass dieses Bild nicht adäquat ist. Dort tanzen die Menschen nicht alleine, sondern alle mit allen, jeder innerhalb seiner eigenen Freiheit – aber mit einem dezidierten Gemeinsinn.
The Lobster. R.: Giorgos Lanthimos. Vereinigtes Königreich 2015.

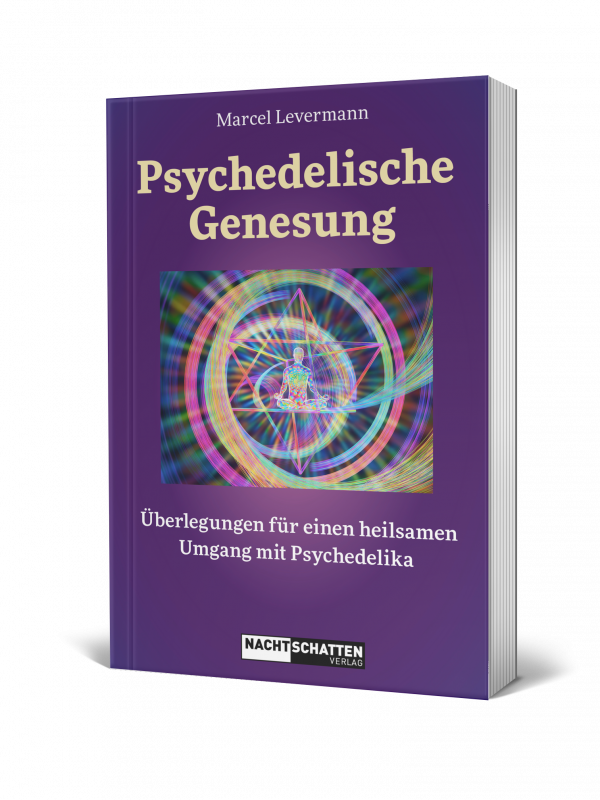



tres bien !